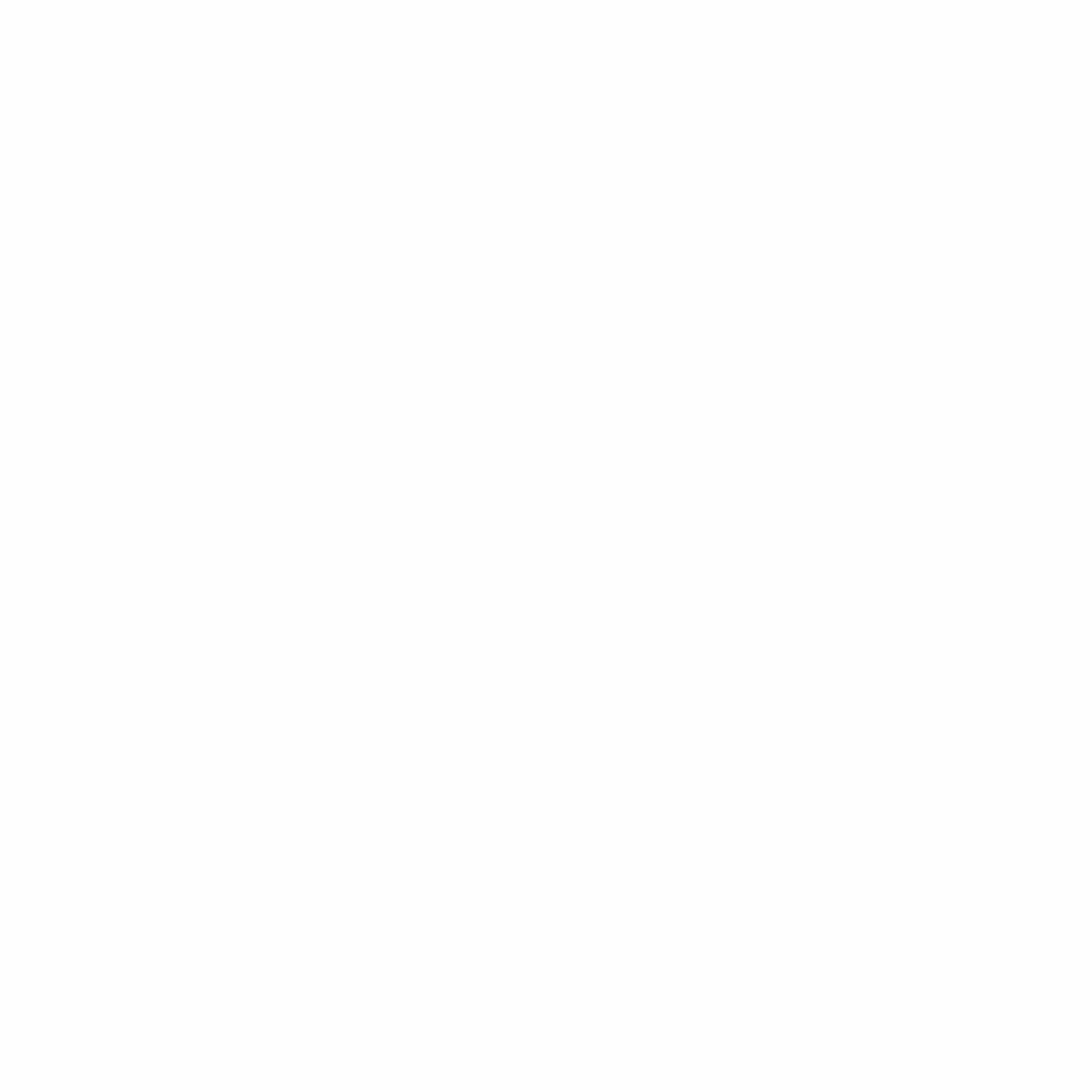Share This Article
Sie fordern von der Stadt Zürich die Entfernung rassistischer Embleme und Häusernamen im Niederdorf: Die Gründer des neuen Antirassismus-Kollektivs «Mir Sind Vo Da» Ben Pauli (26) und Dembah Fofanah (28). Anfang Mai starteten sie mit dem Online-Magazin VO DA mit dem Ziel, dezidiert Rassismus und Diskriminierung im schweizerischen Alltag zu benennen und strukturell tief verankerten Rassismus zu dekonstruieren. Ein Gespräch über Rassismus im Zürcher Alltag und im System, und was wir alle tun müssen, um ihn zu überwinden.
Valerie: Es wäre schön, es bräuchte euch gar nicht. Also im Sinn, dass eine Zugehörigkeit, dass alle, die hier leben und sich von hier fühlen, von hier sind, gar nicht erst in Frage gestellt würde. Wo beginnt bei der scheinbar harmlosen Herkunftsfrage die Diskriminierung und wo hört die menschliche Neugierde auf?
Ben: Wenn man auf die Frage, woher kommst du, die Rückmeldung «vo da» bekommst, sollte man das annehmen und muss nicht nachfragen: «Nei, ich meine, vo wo chunsch du würkli?» Das Nachfragen impliziert, so wie du aussiehst, kannst du nicht «vo da», also keine*n Schweizer*in sein bzw. der Schweiz zugehörig sein. Das ist problematisch.
Dembah: Ich habe Verständnis für aufrichtiges Interesse, aber wir Menschen machen unbewusst innert Bruchteilen von Sekunden Zuschreibungen, die wir dann anschliessend bestätigt wissen wollen. Oft sucht jemand auch nur nach einem guten Anlass für Smalltalk, um dann etwas über eine neue Kultur oder womöglich eine neue Feriendestination zu erfahren. Da bist du bei mir falsch, aber ich kann dir gerne etwas über Oerlikon, wo ich aufgewachsen bin, erzählen.
Ben: Die Resonanz war riesig. Wir erhielten gleich am Anfang an sehr viele Zuschriften von Interessierten. Wir treffen nach der Demonstration diesen Samstag potentielle neue Mitglieder.
Dembah: Die erste Mitgliedschaft wurde eine Stunde nachdem wir online gingen beantragt. Da gab es noch nicht mal ein Foto von uns auf der Webseite, keine Namen, niemand wusste, wer wir überhaupt sind. Sofort erreichten uns über Instagram, wo wir sehr aktiv sind, Nachrichten von jungen Leuten, die von Rassismus betroffen sind. Sie seien im Lehrbetrieb oder in der Schule aufgrund ihres Namens oder ihres Aussehens rassistisch diskriminiert worden. Offenbar schaffen wir einen Ort, wo Betroffene Gehör bekommen und ihre Anliegen platzieren können.
Wir wollen Rassismus und Diskriminierung im Alltag hier benennen und dafür eine mediale Plattform schaffen.
Ben Pauli
Weltweit finden nach dem Mord des Schwarzen Amerikaners George Floyd durch weisse Polizisten in Minneapolis anhaltende Antirassismus-Demonstrationen statt. Alte Denkmäler, die an dunkle Kapitel der Kolonialzeit erinnern, werden von den Sockeln gestossen. Wie geht es euch dabei, jetzt mitten drin aktiv zu werden?
Dembah: Es ist ein Zufall, dass wir den Zeitpunkt so erwischten. Rassismus ist gerade das Thema der Stunde und im medialen Fokus. Uns trifft und beschäftigt es aber natürlich schon unser Leben lang. Sehr viele Leute meldeten sich bereits vor dieser riesigen globalen Protestwelle, also bevor am 25. Mai das Zeugenvideo der Ermordung von George Floyd viral ging und den Stein für die aktuelle Protestwelle ins Rollen brachte.
Ben: Mit der globalen Protestwelle wurde die Aufmerksamkeit auf uns natürlich grösser, was einerseits positiv für uns ist. Andererseits besteht aber gerade die Gefahr, dass die aktuelle, von den USA ausgehende globale Welle unsere Absicht und Anliegen relativiert. Wir konzentrieren uns nicht auf die USA, sondern auf die Schweiz. Wir wollen Rassismus und Diskriminierung im Alltag hier benennen und dafür eine mediale Plattform schaffen.
Welchen persönlichen Bezug zu den USA habt ihr, wenn überhaupt?
Dembah: Wir sind keine Experten zu institutionellem Rassismus in den USA. Ich war während dem Gymnasium zwar ein Jahr im Austausch in Ohio, ziemlich auf dem Land und machte dort ebenfalls meine persönlichen Erfahrungen mit Rassismus.
Ben: Mein Vater ist Afro-Amerikaner, aber meine Kenntnisse der USA beschränken sich auf die eine Region, wo ein Teil meiner Familie lebt. Aber natürlich beschäftige ich mich mit dem strukturellen Rassismus in den USA. Zudem haben meine Grosseltern und mein Vater mir häufig von ihren Erlebnissen erzählt. Diese Bewegung, die nach dem Mord an George Floyd entstand, kam für mich nicht überraschend. Mordfälle an Afro-Amerikaner*innen durch weisse Polizisten sind nicht neu, sie werden jetzt einfach vermehrt gefilmt.
Ich habe das Zeugenvideo bis heute nicht angeschaut, ich schaue keine Lynch-Videos, es sei denn, meine Zeugenschaft verlangt es.
Dembah: Das Zeugenvideo brachte das Fass zum Überlaufen, inmitten der Pandemie, die Afroamerikaner*innen überproportional trifft. Ich persönlich halte ein Video, das ein paar Tage früher im Netz auftauchte und das ursprünglich weniger Aufmerksamkeit erhielt, für mitverantwortlich. Dieses zeigt, wie tief Rassismus im System der Vereinigten Staaten verankert ist. Die weisse Amerikanerin Amy Cooper rief im Central Park die Polizei an und behauptete ein Afro-Amerikaner würde sie bedrohen.
Der ironischerweise noch denselben Namen hatte, Christian Cooper, wie sich herausstellen sollte.
Dembah: Zum ersten Mal ging ein Video viral, wo eine weisse Person von einem Schwarzen gefilmt wird, während sie ihre Hautfarbe als Waffe gegen ihn, in diesem Fall ein völlig unschuldiger Vogelbeobachter, einsetzt. Das wühlte mich auf, obwohl es keinen grausamen Mord zeigt. Die Grausamkeit liegt vielmehr in dieser Selbstverständlichkeit der Frau, die im Wissen handelte, dass das System für Weisse und gegen Schwarze gebaut wurde. Das so klar auf Video mit anzusehen, war sehr heavy, bestimmt für alle von Rassismus betroffenen Amerikaner*innen.
Die Schweiz ist auch von strukturellem Rassismus betroffen. Beispielsweise fehlt es an Repräsentation der gesellschaftlichen Diversität in öffentlichen Ämtern oder in den Medien.
Dembah: Über all die Jahrzehnte haben Kulturschaffende und Akademiker*innen versucht aufzuklären. Es gibt eine ganze Reihe von Rassismus Forscher*innen, zu denen wir uns aber überhaupt nicht zählen können oder wollen. Es gibt hervorragende Leute, wie Jovita Dos Santos Pinto, die Watson Anfang Mai zum Thema Rassismus in der Corona-Krise interviewte. Da standen teils sehr bedenkliche Kommentare … nennen wir es doch beim Namen, rassistische Kommentare. Sie ist eine unter vielen Betroffenen und arbeitet zurzeit an ihrer Dissertation zu diesem Thema.
Ben: Wir mussten uns schon immer mit Rassismus befassen, weil wir, seit wir leben, damit konfrontiert sind. Unsere Expertise sind quasi unsere persönlichen Erfahrungen sowie unsere Auseinandersetzungen mithilfe von Büchern und Texten.
Habt ihr Angst, dass die aktuelle Aufmerksamkeitswelle für Rassismus-Fragen bald wieder nachlässt und wenig von der aktuellen Stosskraft bleibt?
Dembah: Aktuell setzen sich auch viele weisse Menschen mit Rassismus auseinander. Sie hören Podcasts, lesen in der Zeitung darüber und in den Sozialen Medien ist das Thema omnipräsent. Viele nehmen an Kundgebungen teil. Das ist notwendig und wichtig. Wir sind uns aber bewusst, dass die Medien sich wohl bald auf etwas Neues stürzen werden.
Ben: Es wäre schön, das Interesse bliebe auf dem jetzigen Stand. Dass viele Leute schwarze Quadrate über Instagram verbreiten ist schön und gut, aber wenn man ausserhalb der Sozialen Medien wegschaut und nicht gegen Rassismus aufsteht, ist das nicht zielführend. Dann geht es nämlich nicht darum, etwas aktiv gegen Rassismus zu unternehmen, sondern eher darum, sich selbst in den Sozialen Medien als Anti-Rassist*in darzustellen.
Es gibt Aktivist*innen, die den klaren Standpunkt vertreten, weil Rassismus uns alle angeht, sollen Nicht-Betroffene sich selbständig mit dem Thema aktiv auseinandersetzen und daran arbeiten. Sie sagen auch, Rassismus sei ein Problem der Weissen.
Dembah: Es ist wichtig, dass Nicht-Betroffene aktiv eine klare Haltung gegen Rassismus einnehmen. Es reicht nicht zu sagen, ich bin nicht rassistisch, weil rassistisch will ja eh niemand sein. Aber du kannst dir auch nicht einfach selber einen Stempel aufdrücken oder ein Zertifikat dafür abholen.
Antirassistisches Handeln ist mit mehr Aufwand verbunden, als gewisse Hashtags zu verwenden.
Dembah Fofanah
Ben: Man kann nicht von heute auf morgen sagen, ich bin ab jetzt nicht mehr rassistisch und damit hat es sich dann.
Dembah: Antirassistisches Handeln ist mit mehr Aufwand verbunden, als gewisse Hashtags zu verwenden. Heute ist praktisch sämtliches Wissen in der Hosentasche verfügbar, ohne dass man jetzt wissenschaftliche Bücher lesen müsste. Es gibt viele einfache Videos und Kanäle in den Sozialen Medien, die antirassistisches Handeln erläutern. Nichtsdestotrotz hat es uns schon bewegt, wie viele Menschen ein Online-Bekenntnis gegen Rassismus abgegeben haben. Aber du musst diese Online-Bekenntnis in die Offline-Welt mitnehmen und dieses dort demonstrieren.
Zum Beispiel eine klare Haltung beziehen betreffend euren Wunsch an die Stadt Zürich, die rassistischen Häusernamen und Malereinen im Niederdorf umzubenennen bzw. zu entfernen? Das Haus «Zum kleinen Mohren» am Neumarkt 22 und zwei weitere Häuser, die mit dem M-Wort benannt sind. Ihr habt eure Community dazu ermutigt, ein persönliches Bevölkerungsanliegen an die Stadtpräsidentin Corine Mauch zu schreiben.
Gerade kam eine Rückmeldung vom Stadtpräsidium, das versichert, dass man der Sache nachgeht. Das brauchte aber wohl einiges an Vorarbeit, oder?
Dembah: Ich schrieb bereits anfangs Jahr Stadtrat Daniel Leupi, dem Vorsteher des Finanzdepartments und somit verantwortlich für die Abteilung «Liegenschaften Stadt Zürich» als Privatperson eine Mail, noch bevor es das Kollektiv Vo da gab. Leupi antwortete man würde das Lokal «Café Mohrenkopf» zwar umbenennen, aber den rassistischen Namen des Hauses «Zum Mohrentanz», worin sich das Lokal befindet, würde ja kaum jemand kennen, obwohl er gross über der Eingangstüre steht. Mit dieser Antwort abgespeist dachten wir, nun gut…
Ben: … dann lernen ihn jetzt eben bald alle kennen. In unserem Offenen Brief an die Direktorin des Amts für Städtebau, Karin Gügler, forderten wir, die rassistischen Zeitzeugen zu entfernen.
Dembah: Ihre Antwort lautete: «Der problematische, rassistische Hintergrund der Namen und der Darstellung ist offensichtlich.» Trotzdem – oder genau deswegen – sollen sie aber bleiben, damit wir uns an Rassismus aus der Vergangenheit erinnern und uns damit auseinandersetzen könnten. Gleichzeitig behauptet die Stadt Zürich, sie würde sich aktiv gegen Rassismus einsetzen. Die Stadt Zürich will diese koloniale, stereotypisierte Darstellung eines Schwarzen Jungen, sowie die Plakette des Hauses als sogenanntes «unbequemes Denkmal» stehen lassen. Die rassistischen Häusernamen und Malereien wurden unter anderem mit Holocaust-Gedenkstätten verglichen. Aber dieser Vergleich hinkt.
 Foto: Kollektiv Vo da.
Foto: Kollektiv Vo da.
Ben: Im Dörfli findet keine aktive Auseinandersetzung mit diesen Zeitzeugen statt, ergo auch nicht mit dem Rassismus der Vergangenheit und schon gar nicht mit jenem in der Gegenwart. Ausserdem ist es inkonsequent und widersprüchlich von der Stadt, die Änderung des rassistischen Namens des Restaurants zu fordern und die rassistischen Häusernamen stehen zu lassen.
Dembah: Die rassistischen Häusernamen im Dörfli sind nichts anderes als eine Reproduktion, und wenn das von den Behörden so stehengelassen wird, führt das ganz klar zur Legitimierung einer rassistischen Denkweise und Handlungsweise. Wir unterstellen der Stadt keinerlei bösartiger Wille darin, dass sie sich all die Jahre nicht damit befasst haben. Wir wissen, wie der Stadtrat aussieht und mit ziemlich grosser Sicherheit handelt es sich bei den meisten um Leute, die wahrscheinlich nicht von Rassismus betroffen sind.
Mir, als schreibende Person, fällt auf, dass die Deutsche Sprache einige Verwirrungen und Lücken im Vokabular aufweist, was eine grundlegende Basis ist, um antirassistisch zu handeln. Wenn ich in den Tagesmedien Begriffe wie «Rassenunruhen» lese, oder «Mischling», dann wird mir bewusst, wie viel Arbeit noch vor uns liegt.
Dembah: Wenn man Rassismus abbauen will, wenn wir dieses System der weissen Vorherrschaft dekonstruieren wollen, müssen wir mit der Sprache beginnen und der Vorstellung von vermeintlich homogenen Menschengruppen. In Amerika existiert das Konzept «Race», wo Menschen in soziale Kategorien eingeteilt werden. Die direkte deutsche Übersetzung «Rasse», deren Definition eher biologische Unterschiede unterstreicht, findet man im Tierreich, aber sie funktioniert bei einer Anwendung auf uns Menschen nicht, weil wir alle der gleichen Spezies angehören.
Wie würde man im Deutschen Menschen, die sich nicht «weiss» sehen, bezeichnen? Gibt es da überhaupt einen Begriff?
Dembah: Es gibt den englischen Begriff «PoC» (People of Colour), wofür keine wirkliche Übersetzung im Deutschen existiert. Mit diesem Begriff identifizieren sich Menschen, die als «anders» gesehen werden und deshalb Rassismuserfahrungen machen müssen. Man muss wirklich mit der Sprache anfangen, und eine Sprache dafür entwickeln, um Rassismus auch im Deutschen konsequent benennen zu können.
Niemand wird als Rassist geboren, sondern dazu erzogen. Müsste Antirassismus in einer Form zum Pflichtstoff in der Schule zählen?
Ben: Müsste es, tut es aber nicht. Ich als Primarlehrer sage ganz klar, Kinder brauchen auch in der Schule Raum, um den Alltag zu bestreiten, weil Eltern teils nicht in der Lage sind, ausreichende Aufklärungsarbeit zu leisten. Die Schule ist der Ort, wo Kinder, Betroffene, sowie Nicht-Betroffene lernen müssen, Rassismus als gesellschaftliches Konstrukt zu verstehen, um ihn später überwinden zu können. Bis jetzt gibt es aber keinen verbindlichen Lehrauftrag. Struktureller Rassismus wird auch nicht in der Lehrer*innenausbildung thematisiert. Als Verein sehen wir das als sehr problematisch. People of Colour sind in der Schweiz nach wie vor eine benachteiligte Minderheit. Zahlreiche Studien belegen, dass eine Chancengleichheit, beispielsweise auf dem Arbeitsmarkt, nicht gegeben ist. Wir müssen die Strukturen im Bildungssektor bereits vor dem Schuleintritt ändern, um Chancengleichheit zu schaffen.
Habt ihr ein Beispiel?
Dembah: Ich studierte Wirtschaftswissenschaften, einen der wohl grössten Studiengänge in der Schweiz. Wir waren im ersten Jahr etwa tausend Studierende. Wenn ich jeweils in den grossen Hörsälen um mich schaute, sah keiner der anderen Studierenden so aus wie ich, geschweige denn unter den Professor*innen oder Tutor*innen.
Ben: Ich unterrichtete bereits an einigen Schulen, habe aber bisher kaum eine Lehrperson kennengelernt, die ähnlich aussieht wie ich.
Rassismus hat sich seit der Zeit des Sklavenhandels und des Kolonialismus laufend verändert, aber ist nie verschwunden.
Ben Pauli
Dembah: Wir müssen lernen zu verstehen, dass wir alle rassistisch sozialisiert wurden. Als Kind fand ich es jeweils sehr verwirrend, aufgrund meiner Hautfarbe, zu hören, ich solle zurückgehen, woher ich gekommen sei. Wohin zurück? Wo soll ich denn hin? Ich bin ja «vo da». Mit der Zeit habe ich dann verstanden, dass diese negativen Zuschreibungen im Alltag zu einer Ungleichbehandlung führen, die sich dann später, wie schon erwähnt, unter anderem bei der Job- oder Wohnungssuche niederschlägt.
Ben: Nicht-weisse Kinder haben leider wenig prominente Vorbilder ausserhalb vom Sport oder Entertainment. Aufgrund dieser Klischees werden die nicht-weissen Kinder dann auch genau in diesen Bereichen vermehrt gefördert. Man schickt das Kind also ins Tanzen statt ins Chemielabor. Rassismus hat sich seit der Zeit des Sklavenhandels und des Kolonialismus laufend verändert, aber ist nie verschwunden. Wir konstruieren nach wie vor aufgrund derselben und weiteren Merkmalen, wie der Hautfarbe, der ethnischen Zugehörigkeit oder der Herkunft «das Andere», welches wir als fremd von der Referenzkultur beurteilen. Und wenn ein Gegenüber sich als kategorisiert, rassifiziert empfindet, ist auch eine vermeintlich gut gemeinte Zuschreibung problematisch.
Dembah: Zum Beispiel: «Du kannst bestimmt gut Tanzen und Basketball spielen.» Das mussten wir ständig erleben. Nicht böse gemeinte Aussagen sind Ausdruck eines weissen Privilegs, sich eben nicht mit solchen Klischees und Vorurteilen auseinandersetzen zu müssen. Wir haben dieses Privileg nicht. Wir müssen uns mit solchen Zuschreibungen auseinandersetzen, denn sie führen auch zu Verallgemeinerungen und Stigmatisierungen oder Verleumdungen, auch bei Straftatbeständen.
Stichwort Polizeikontrollen. Was ist beim Racial Profiling wichtig zu wissen?
Ben: Sämtliche meiner Freund*innen oder Bekannten, die die gleiche Hautfarbe wie ich haben, hatten mindestens einmal im Leben ein negatives Erlebnis mit der Polizei, wo die Hautfarbe Auslöser war oder zumindest eine Rolle spielte. Racial Profiling ist ganz klar struktureller Rassismus. Das sind keine Einzelfälle. Und wir wollen nicht, dass diese zu Ausnehmen reduziert werden.
Dembah: Ich wandte mich an bestimmte Medien betreffend Verwendung von Symbolbilder bei mehreren, voneinander unabhängigen Artikeln über die Stadtpolizei, wo wiederholt Bilder gewählt wurden, wo weisse Polizisten einen Schwarzen Mann verhaften. Ich fragte die Redaktionen, warum sie ausgerechnet dieses Bild verwenden würden. Will ja nicht heissen, dass es keine Schwarzen gibt, die Straftaten begehen, das gibt es ja genauso, wie es auch weisse Straftäter*innen gibt. Laut Statistiken sind junge Männer die häufigsten Straftäter, aber wir verdächtigen ja deswegen nicht gleich sämtliche jungen Männer, wenn ein anderer gegen das Gesetz verstossen hat. Die Redaktionen verstanden mein Anliegen, dass ihre Auswahl Vorurteile befeuern und somit Racial Profiling begünstigen würde. Sie meinten jedoch, dass in den Bilddatenbanken nur eine begrenzte Auswahl zu finden sei und quasi immer würden Schwarze Männer als Täter oder Verdächtige dargestellt.
Gibt es nebst dem Magazin bereits konkrete Pläne?
Ben: Noch nicht. Wir fangen jetzt einfach mal mit dem Magazin an. Weitere Ideen sollen im Kollektiv entstehen und unsere Mitglieder können Input geben. Am Samstag, 13. Juni gibt es wieder eine Demonstration gegen Rassimsus.
Dembah: Genau, jetzt ist es ja wichtig Haltung zu zeigen. Wann denn, wenn nicht jetzt? Wir haben es in der Hand, wie wir hier in der Schweiz das Zusammenleben gestalten möchten und wie wir mit anderen Menschen umgehen wollen. Darin hat eine Toleranz oder sogar Akzeptanz von Rassimus keinen Platz.