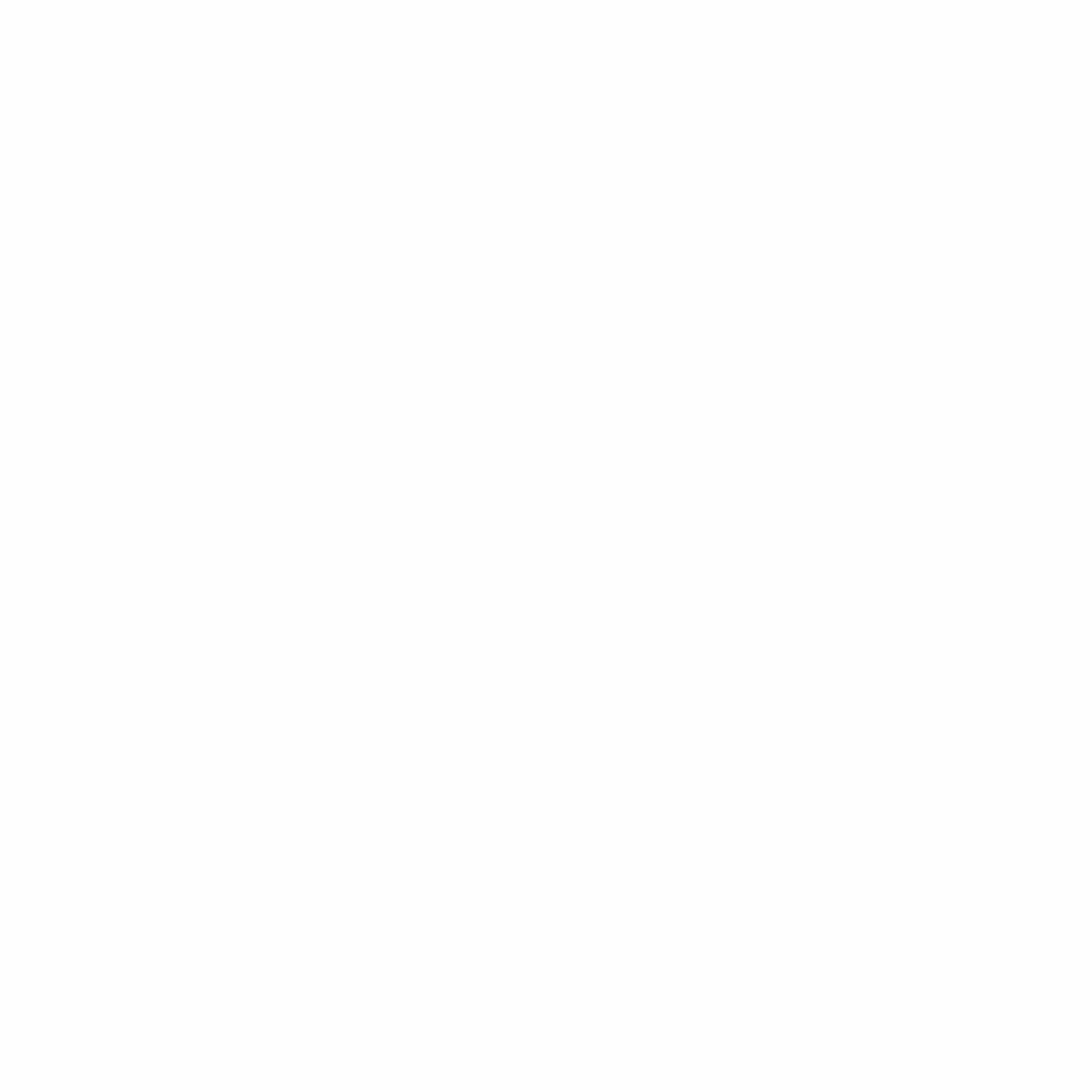Share This Article
In Kenia hat M-Pesa den Alltag für Millionen von Menschen revolutioniert. Das mobile Bezahlsystem erleichtert insbesondere Frauen den Zugang zu finanziellen Mitteln. Einen grossen Nutzen zieht allerdings auch die Anbieterin selbst.
Monica Njeri sitzt hinter Haufen von Kohlköpfen und wartet auf Kundschaft. Ihre blondierten Dreadlocks hat sie zusammengebunden. An diesem regnerischen Aprilmorgen läuft wenig auf dem Markt in Kibera, einem der Armenviertel der kenianischen Hauptstadt Nairobi. Njeri arbeitet zusammen mit ihrer Mutter als Gemüseverkäuferin. Die Dreissigjährige gehört zur Mehrheit der Kenianerinnen und Kenianer mit Uni-Abschluss, für die kein Platz auf dem ausgetrockneten Arbeitsmarkt ist. «Wir hoffen auf den Tag, an dem ein Fenster aufgeht für einen Job, der meiner Qualifikation entspricht», gibt sie sich zuversichtlich. Das Gemüse kommt von Kleinbauern aus der Gegend um den Mount Kenia oder aus dem benachbarten Tansania. Den Handel über mehrere Hunderte von Kilometern wickelt sie über ihr Mobiltelefon ab, mit der Bezahlplattform M-Pesa. Das «M» steht für mobil, und «Pesa» heisst in der Landessprache Suaheli Geld. Mit wenigen Clicks bezahlt sie die Zwischenhändler vor Ort für den Einkauf ab Hof, den Transport und deren Kommission. Die Grossmutter und die Mutter reisten dafür noch den langen beschwerlichen Weg zu den Bauern oder schickten jemanden mit dem Bargeld. Bankkonten hatte kaum jemand. Schon gar nicht auf dem Land.
Eine Bank, die keine ist: Die M-Pesa-Drehscheibe
Als 2007 das Telekommunikationsunternehmen Safaricom M-Pesa und damit den virtuellen Geldtransfer einführte, war das eine Revolution für Millionen von Kenianerinnen und Kenianern. Auch wenn gerade mal zehn Prozent der mündigen Bürgerinnen und Bürger über ein Bankkonto verfügten, war es plötzlich innert Sekunden möglich, Geld aus der Hauptstadt Hunderte von Kilometern zu den Verwandten im Dorf zu schicken; oder Schulgelder zu bezahlen ohne stundenlanges Schlangestehen an Bankschaltern. Mit dem Slogan «Banking the unbanked» verschaffte Safaricom ohne Bankenlizenz einem Grossteil der Bevölkerung Zugang zu formalen Zahlungssystemen. Die kenianische Bankenaufsicht erliess hierfür eine Sondergenehmigung.
Zunächst lief M-Pesa als einfacher Geldtransferdienst über das Telefonnetz. Dann hat es sich über die Jahre zu einer digitalen Finanzplattform mit verschiedenen Serviceleistungen entwickelt: Die Nutzerinnen und Nutzer können heute Kredite aufnehmen, Rechnungen abwickeln oder internationale Überweisungen tätigen und vieles mehr. Unterdessen läuft M-Pesa auch über eine App und funktioniert nahtlos mit den Systemen von Banken und anderen Mobilfunkbetreibern zusammen. Es gibt kaum einen Haushalt ohne Zugang. Alles wird über M-Pesa abgewickelt: Stromrechnungen begleichen, der Einkauf im Supermarkt, Flüge buchen, Versicherungen bezahlen.
Heerscharen von Agentinnen und Agenten
Ob in der Hauptstadt oder in ländlichen Ballungszentren: Das Safaricom-Grün ist heutzutage omnipräsent und integraler Bestandteil der Infrastruktur. Ganze Häuserzeilen sind mit dem Branding des Mobilfunkgiganten versehen. Die maximale Durchdringung des Alltags war ausschlaggebend für den Geschäftserfolg. Dafür brauchte es Heerscharen von M-Pesa-Agentinnen und -Agenten. Deren Rolle ist vergleichbar mit jener von Bankomaten, wo man Geld auf sein Konto deponiert oder sich bar auszahlen lässt. Nur ist M-Pesa keine Bank, und die Agentinnen und Agenten erbringen den Service gegen eine Kommission persönlich.
Eine von ihnen ist Lydia Awuor. Auch sie arbeitet in Kibera. Täglich ausser sonntags sitzt sie von morgens früh bis spätabends in ihrem kleinen Shop. «Das Geschäft ist sehr volatil, ein guter Tag bringt vielleicht 40 Kunden.» Die 25-Jährige unterstützt mit dem Verdienst ihre fünf jüngeren schulpflichtigen Geschwister, die 300 Kilometer westlich beim Viktoriasee leben. Für eine Transaktion von umgerechnet vierzig Franken bezahlt man rund 30 Rappen Gebühren. Davon erhält die Agentin etwa die Hälfte, die andere geht an Safaricom als Kommission und als Steuern an den Staat. Im Schnitt trifft man in kenianischen Städten alle zehn bis zwanzig Meter auf eine M-Pesa-Agentur, an die 200 000 soll es im ganzen Land geben. «Inzwischen gibt es viel zu viele», klagt Lydia. «Und seit Safaricom die Kommissionen vor zwei Jahren kürzte, ist die Arbeit wenig gewinnbringend.»

Lydia Awuor ist eine von zehntausenden von Agentinnen, die sich dank mobile money Serviceleistungen über Wasser halten © Kelvin Juma
Kleinkredit über Social Media
Generell haben Frauen in Kenia aber von M-Pesa profitiert. Zum Beispiel Elisabeth Ondego. «Vor fünf Jahren lag ich nachts wach, als mein ältester Sohn vor dem Staatsexamen stand und ich pleite war.» In jener Nacht kam ihr die zündende Idee. Sie machte eine spontane Anfrage in einer Facebook-Frauengruppe, ob jemand interessiert wäre, ein Online-Table-Banking zu gründen und täglich 100 Schilling über M-Pesa zu senden, umgerechnet etwa 70 Rappen. Table-Banking ist in Kenia als Strategie für informelle Darlehen etabliert. Die Mitglieder einer festen Gruppe sammeln gemeinsam vereinbarte Beiträge ein und vergeben im Rotationsprinzip Darlehen an die Mitglieder. Das Konzept hilft insbesondere von Armut betroffenen Frauen. In Kenia kommt man grundsätzlich nur schwer an Bankkredite und zahlt hohe Zinsen. Frauen werden zusätzlich diskriminiert, da sie gemäss Erbrecht kaum Land besitzen, das von Banken als Sicherheit verlangt wird. Table-Banking schafft Abhilfe.
Ondegos Idee funktionierte, und das blitzschnell. «Ich konnte es kaum glauben: Am nächsten Morgen hatten über 300 Frauen den Betrag gesandt, und mein Sohn konnte als erster Darlehensempfänger der frisch gegründeten Gruppe ans Staatsexamen.» Ohne M-Pesa wäre es undenkbar gewesen, eine virtuelle Table-Bank in diesem Tempo aufzubauen. Denn die beteiligten Frauen wohnen teilweise Hunderte Kilometer voneinander entfernt, viele sogar in der Diaspora.
Heute verwaltet Ondego ein Netzwerk von über 2400 Frauen. Die Darlehen helfen den Frauen nicht nur in Notsituationen, sondern auch, um kleine Unternehmen zu gründen oder bestehende auszubauen. Eine Frau konnte beispielsweise vom Darlehen ein kleines Restaurant eröffnen, andere erwerben kollektiv Land. Unterdessen gibt es in Kenia Tausende solcher Online-Table-Banking-Gruppen. «Vielen Frauen wie mir ist der Sprung aus der Armut gelungen mit diesem Konzept», ist Ondego überzeugt. Für sich selbst konnte sie dank ihrer Idee in einem bescheidenen Vorort Nairobis ein Haus bauen.
Monopol mit Schattenseiten
Laut Weltbank verfügen in Kenia heute fast 80 Prozent der Erwachsenen über ein Bankkonto, nicht zuletzt dank M-Pesa. Es gibt Studien, die davon ausgehen, dass das mobile Bezahlsystem tatsächlich zur Bekämpfung von Armut beigetragen hat, so wie das Ondego vermutet. Die extreme Armut sei um zwei Prozent gesunken. Der britische Entwicklungsdienst, M-Pesas Geldgeber erster Stunde, kam hingegen in einer eigenen Studie zum Schluss, dass das mobile Bezahlsystem diesbezüglich wirkungslos blieb. Kritische Stimmen beanstanden zudem, dass das mobile Bezahlsystem auch neue Probleme bringe und beispielsweise in eine Schuldenfalle führen könne. Über M-Pesa kann man sehr einfach bei Sportwetten mitmachen, dubiosen Fernsehpredigern Geld überweisen oder Kleinkredite mit unvorteilhaften Konditionen aufnehmen. Als problematisch gilt auch die Monopolstellung Safaricoms: Rund die Hälfte des kenianischen Bruttosozialprodukts wird gemäss Schätzungen über M-Pesa abgewickelt. Am meisten verdienen am Geschäft mit dem mobilen Geld daher die Telekomgesellschaften selbst. Dass Safaricom als privates Unternehmen über die mächtigste öffentliche digitale Infrastruktur für Geld in der Region verfügt, ist zudem ein Risiko. Wenn diese eine Handelsplattform untergeht, kommt das gesamte Wirtschaftsleben Kenias zum Stillstand.
Doch für die breite Bevölkerung überwiegen die Vorteile des mobilen Bezahlsystems die Schattenseiten. Ohne Mengen von Bargeld auf sich fühlt sich die Gemüsehändlerin Monica Njeri auch wohler. «Das Geld ist sicher», sie klopft lächelnd auf ihr Smartphone in der Schürzentasche, ihr virtuelles Portemonnaie.
Diese Reportage erschien im Juni 2023 in Moneta, dem Magazin für Geist und Geld, hrsg. von der Alternativen Bank, Schweiz, Fotos: Kelvin Juma